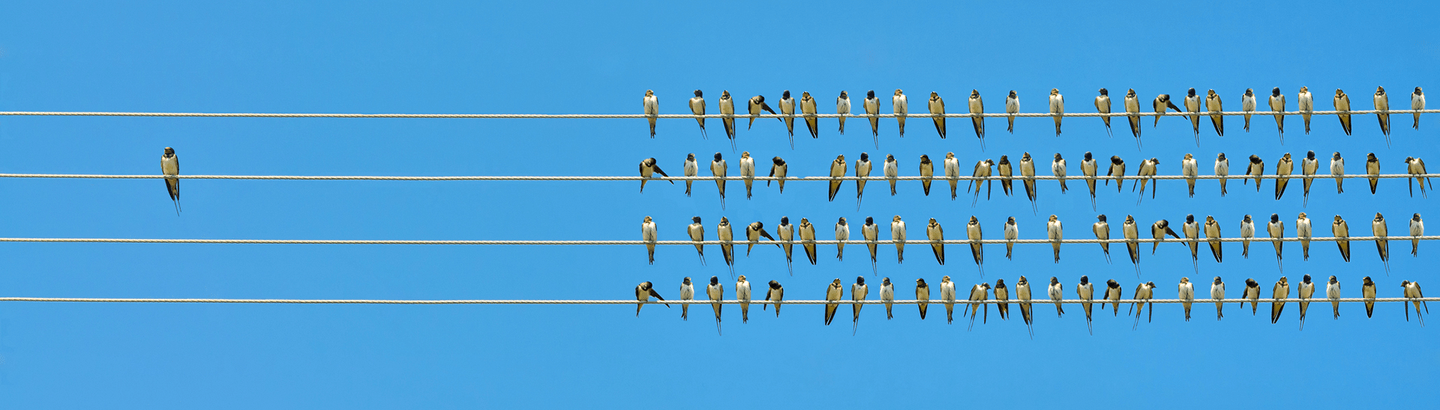
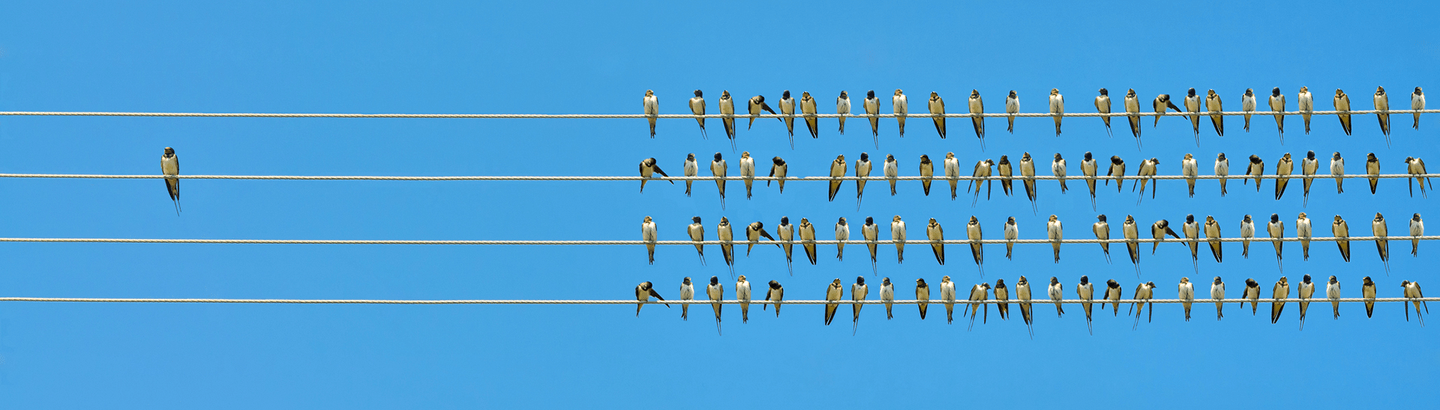
Selbstständig oder unselbstständig? – Abgrenzung in der Praxis
Die Unterscheidung zwischen selbständiger und unselbständiger Erwerbstätigkeit prägt nicht nur die sozialversicherungsrechtliche und steuerliche Behandlung einer Person, sondern hat auch weitreichende finanzielle und rechtliche Konsequenzen. Gerade moderne Arbeitsverhältnisse, flexible Auftragsmodelle und Tätigkeiten in der Kreativ- und Beratungsbranche stellen die Praxis vor komplexe Herausforderungen – mit teils gravierenden Folgen im Fall von Fehleinschätzungen.
Nach Schweizer Recht und Praxis gilt als selbständig, wer unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung handelt, das wirtschaftliche Risiko trägt und unabhängig ist. Wesentliche Abgrenzungsmerkmale sind:
- Unternehmensrisiko: Eigene Investitionen in Betriebsmittel, Materialeinkauf, Inkassorisiko gegenüber Kunden (z B. Risiko von Zahlungsausfällen), eigenverantwortliche Auftragsbeschaffung und Marketing, eigene betriebliche Organisation, z.B. eigene Geschäftsräumlichkeiten oder Betriebsausstattung, Tragen von wirtschaftlichen Verlusten und Gewinnen.
Ein Laptop, Büroausstattung oder geringfügige Anschaffungen allein reichen nicht aus, wenn kein unternehmerisches Risiko besteht, oder wenn es um die Durchführung eines einzigen Grossauftrags ohne weitere Kunden und ohne wesentliche Entscheidungsfreiheit geht.
- Weisungsfreiheit: Für eine selbständige Tätigkeit darf keine Integration in die Organisation und Abläufe des Auftraggebers, d.h. keine Unterstellung im Sinne eines Arbeitsverhältnisses, vorliegen. Dies beinhaltet die Freiheit bei der Wahl der Arbeitszeit und der Arbeitsweise sowie keine Bindung an die Weisungen des Auftraggebers oder eine Präsenzpflicht.
Ein sporadisch vorgegebener Arbeitsort oder Teilnahme an bestimmten Meetings zwingt noch nicht zur Einstufung als unselbständig. Auch geringe Anweisungen hinsichtlich Arbeitsausführung oder Qualitätsanforderungen sind üblich und nicht per se problematisch, solange die Entscheidungsfreiheit überwiegend gewahrt bleibt.
- Gewinnerzielungsabsicht: Hierzu zählt die sichtbare Teilnahme am Wirtschaftsverkehr, beispielsweise ein Auftritt mit eigenem Firmennamen, Webseite oder Kundenakquise. Eine Tätigkeit, die überwiegend im Rahmen eines Hobbys oder als gelegentliche Nebentätigkeit ohne Nachhaltigkeit ausgeübt wird (Liebhaberei) oder der blosse Anspruch auf Gewinn oder gelegentliche Einnahmen ohne kaufmännische Organisation genügt nicht.
- Wirtschaftliche Abhängigkeit: Typische Merkmale für eine unselbständige Tätigkeit sind, wenn ein wesentlicher Umsatzanteil (mehr als 50 bis 70 Prozent) bei einem einzigen Auftraggeber erzielt wird, wenn es keine Möglichkeit zur Annahme oder Ablehnung von Aufträgen gibt oder wenn ein Konkurrenzverbot oder vergleichbare Einschränkungen vereinbart wurden.
Die eidgenössische Steuerverwaltung verlangt neben der Rechtsform die tatsächliche Ausgestaltung der Tätigkeit als zentrale Grundlage für die steuerliche und versicherungsrechtliche Einstufung. Mehrfach nennt die Rechtsprechung des Bundesgerichts das Gesamtbild als entscheidendes Kriterium (Urteil 9C_739/2019 vom 10.6.2020, Urteil 9C_267/2023 vom 24.6.2024).
Praxisbeispiele
IT-Dienstleister
Ein Informatikspezialist mit Auftragsverhältnis zum Bund wurde vom Bundesgericht als unselbständig eingestuft (Urteil 9C_132/2011). Ausschlaggebend waren Arbeitsleistung vor Ort, enge Einbindung, periodische Rapportpflicht und das Fehlen nennenswerter Investitionen. Die vermeintliche Unternehmerfreiheit war faktisch nicht gegeben.
Fotografin
Eine freie Fotografin, die fast ausschliesslich für Werbeagenturen tätig war, wurde für diese Umsätze nachträglich als unselbständig eingestuft. Gründe: Bindung an die Agentur, mangelnde Eigenverantwortung in der Akquise, Weisungsgebundenheit und wirtschaftliche Abhängigkeit (Urteil 9C_739/2019).
Plattform-Arbeit
Im 2023er Urteil 9C_71/2022 zur Statusfrage von Fahrdienstleistern entschied das Bundesgericht, dass die starke Weisungskontrolle via App, das Fehlen eines echten Unternehmerrisikos und die operative Einbindung zur Einstufung als unselbständig führen.
Liebhaberei und steuerliche Abgrenzung
Keine selbständige Erwerbstätigkeit liegt vor, wenn die Tätigkeit zwar über Jahre ausgeübt wird, aber keine Typik der Gewinnerzielung und kein Marktauftritt bestehen – etwa bei Künstlern mit fortwährenden Verlusten (BGer 2C_206/2011, BGer 2C_360/2021).
Folgen einer Umqualifizierung
Eine nachträgliche Umqualifizierung – etwa bei AHV-Prüfungen, Steuerrevisionen oder Sozialversicherungsprüfungen – kann schwerwiegende Folgen auslösen:
- Nachzahlungen und Beitragskorrekturen: Sozialversicherungsbeiträge inklusive Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil werden rückwirkend für bis zu fünf Jahre erhoben, dazu kommen Verzugszinsen.
- Doppelbelastung: Bei Vorliegen von MWST-Zahlungen und Einzahlungen in Vorsorgesysteme (Säule 3a, Berufliche Vorsorge), drohen komplizierte Rückabwicklungen, steuerliche Nachteile und Doppelabgaben.
- Gefahr von Rückforderungen: Wurden bereits Sozialversicherungsleistungen ausbezahlt, sind Rückforderungen durch Erkennung eines unselbständigen Status rechtlich möglich und oft existenzbedrohend.
- Haftung und Sorgfaltspflichten: Auftraggeber haften auch bei Subunternehmern, wenn sie deren Abrechnung und Status nicht sorgfältig geprüft haben.
Herausforderungen bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten
Bei internationaler Arbeit kann der Sozialversicherungsstatus noch komplexer werden. Dies betrifft insbesondere Grenzgänger oder Berater mit mehreren Standorten. Die Anmeldung, Einordnung und steuerliche Behandlung müssen in solchen Fällen besonders sorgfältig mit Hilfe der zuständigen Behörden und gegebenenfalls Beratung erfolgen.
Tipps und Hinweise
- Gesamtbild prüfen: Die tatsächliche Ausgestaltung zählt – nicht die gewählte Vertragsform oder die Wünsche der Parteien.
- Mehrere Auftraggeber: Einseitige Bindung oder hohe Umsatzanteile bei einem einzelnen Auftraggeber sind ein Warnsignal für eine potenzielle Umqualifizierung.
- Investitionen und Unternehmerrisiko: Für die Tätigkeit müssen eigene Investitionen, Inkassorisiko und eine nachweisbare Gewinnerzielungsstrategie vorliegen.
- Rechtskonforme Verträge: Vertragsklauseln zur Statusfestlegung sind irrelevant, wichtig ist die gelebte Realität.
- Dokumentation: Arbeitszeiten, Projektabbrüche, Eigenwerbung, eigene Buchhaltung und Marktauftritt dokumentieren.
- Fachberatung: Im Zweifel frühzeitig Ihre Treuhänderin, Ihren Treuhänder oder rechtliche Beratung hinzuziehen; relevante Merkblätter und Leitfäden der eidgenössischen Steuerverwatlung und Sozialversicherungen regelmässig heranziehen.
- Grenzüberschreitende Tätigkeiten: Hier gelten besondere Koordinationsregeln; die Zuweisung zum Sozialversicherungssystem unterscheidet sich, etwa für Berater mit Wohnsitz im Ausland
Fazit
Die korrekte Statusabgrenzung und Dokumentation sind essenziell im Schweizer Arbeits- und Steuerrecht. Die durch Praxis, Bundesgericht und Behörden entwickelten Kriterien verlangen eine sorgfältige Prüfung individueller Umstände und laufende Kontrolle der Vertrags- und Arbeitsrealität. Im Zweifelsfall sollte immer fachlicher Rat eingeholt werden, um die Risiken einer Umqualifizierung und ihre oft unterschätzten Folgen von vornherein zu vermeiden.
--> Merkblätter und hilfreiche Quellen
- Merkblatt der ESTV: Besteuerung bei selbständiger Erwerbstätigkeit
Übersicht zu den wichtigsten Kriterien, Abgrenzung gegen unselbständige Tätigkeit und steuerliche Praxishinweise.
https://www.estv2.admin.ch/stp/ds/d-selbstaendige-erwerbstaetigkeit-de.pdf
- Leitfaden Selbstständigkeit – Portal des Bundes (SECO/KMU-Portal)
Schritt-für-Schritt-Anleitung zu den administrativen und rechtlichen Anforderungen der Selbstständigkeit in der Schweiz.
https://www.kmu.admin.ch/kmu/de/home/praktisches-wissen/kmu-gruenden/firmengruendung/erste-schritte/selbstaendigkeit-schweiz-leitfaden.html
- ESTV Merkblatt: Steuerpflicht MWST – selbständige/unselbständige Tätigkeit
Praxishinweise zum Mehrwertsteuerstatus und Abrechnungsmodalitäten.
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/mwst-steuerpflicht/mwst-taetigkeit.html
- Merkblatt für Selbständigerwerbende (Kantonale Beispiele: Solothurn, Zürich, St. Gallen u.a.)
Praktische Hinweise zu Buchführung, Unterlagen und Anmeldung für verschiedene Kantone.
Beispiel Solothurn: https://so.ch/fileadmin/internet/fd/fd-ksta/pdf/np/ste/alljaehrliche_Formulare/Merkblatt_Selbstaendigerwerbende.pdf
Beispiel Zürich: https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/steuern-finanzen/steuern/natuerlichepersonen/2022/est-wegleitungen/321_merkbl_selbst_zh_2022_bf_def.pdf SECO: Merkblatt und Meldepflichten Selbständigkeit/Unselbständigkeit
Übersicht zu gesetzlichen Abgrenzungskriterien und Meldeverfahren.
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/schwarzarbeit/Arbeit_korrekt_melden/Selbstaendige.html
Schweizerischer Treuhänderverband
Blog abonnieren
Möchten Sie keinen Blogartikel verpassen? Abonnieren Sie hier unseren Blog.
