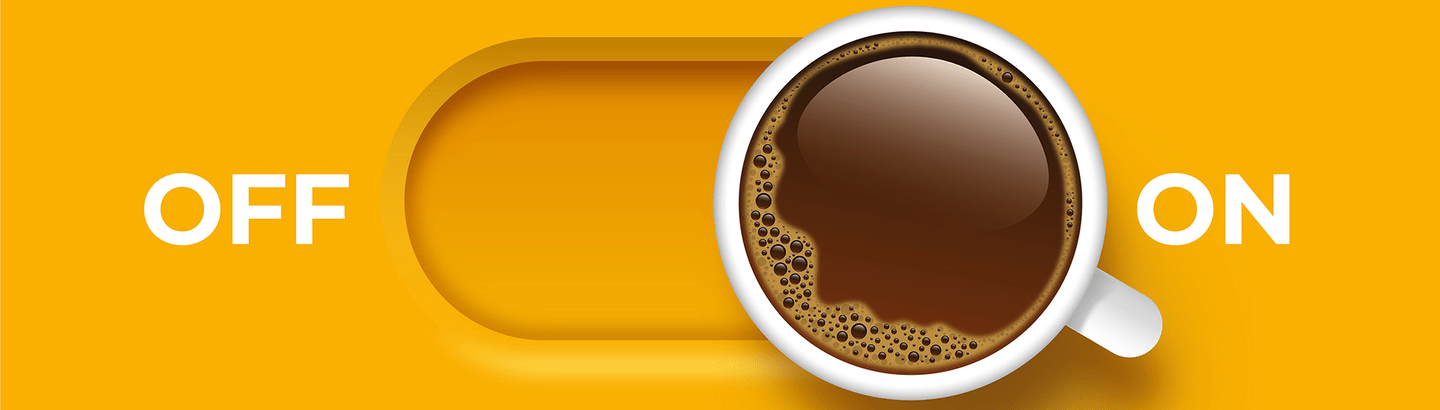
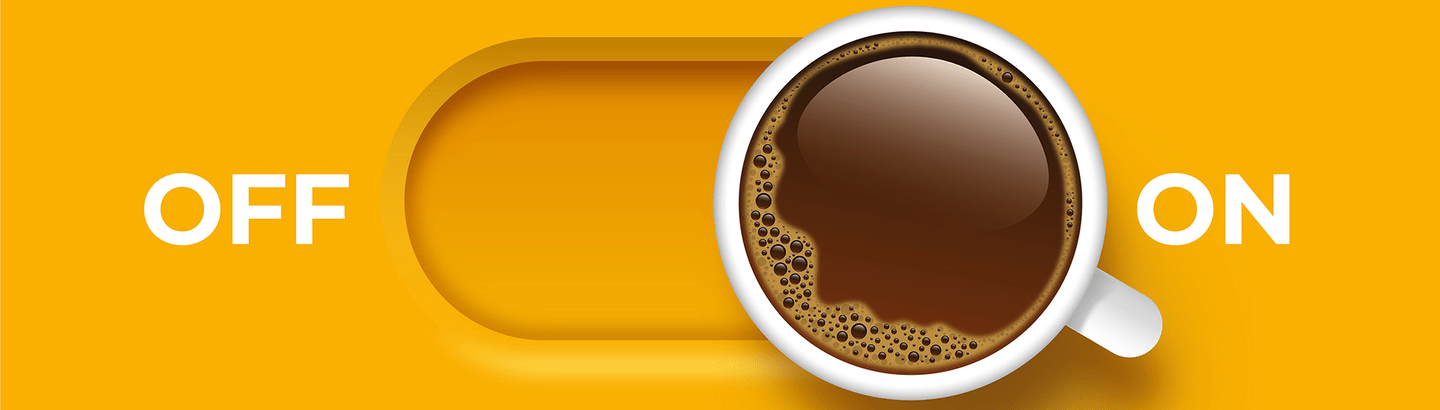
Mehr als nur eine Pause: Wie das Arbeitsrecht Ihre Erholung sichert
Pausen während der Arbeitszeit sind im Schweizer Arbeitsrecht klar geregelt – und dennoch Gegenstand aktueller Diskussionen. Gerade in Zeiten von Flexibilisierung, Homeoffice und zunehmender Arbeitsverdichtung stellt sich die Frage, wie Erholungspausen sinnvoll und rechtssicher gestaltet werden können. Was Sie dazu wissen müssen, erläutert dieser Beitrag.
Die Bedeutung von Pausen im Arbeitsalltag wird immer wieder kontrovers diskutiert. Während gesetzliche Mindestpausen dem Gesundheitsschutz und der Unfallprävention dienen, stehen in der Praxis oft betriebliche Erfordernisse, flexible Arbeitsmodelle oder individuelle Bedürfnisse im Vordergrund. Die jüngste Rechtsprechung – etwa zur Stempelpflicht bei Toilettenpausen oder zu bezahlten Pausen in der Pflege – zeigt, dass das Thema weiterhin aktuell bleibt und Anpassungsbedarf besteht.
1. Gesetzliche Grundlagen: Wer hat Anspruch auf welche Pause?
Das Schweizer Arbeitsgesetz (ArG) verpflichtet Arbeitgeber, die Arbeit durch Erholungs- und Verpflegungspausen zu unterbrechen. Ziel ist es, Überbeanspruchung zu verhindern und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Die wichtigsten Regelungen:
- Bis 5,5 Stunden Arbeitszeit: Keine Pause vorgeschrieben
- 5,5 bis 7 Stunden: Mindestens 15 Minuten Pause
- 7 bis 9 Stunden: Mindestens 30 Minuten Pause
- Mehr als 9 Stunden: Mindestens 60 Minuten Pause
Diese Pausen müssen zwingend gewährt werden. Kürzere Pausen oder der Verzicht darauf sind unzulässig – längere Pausen können aber immer vereinbart werden.
2. Wann gilt die Pause als Arbeitszeit?
Grundsätzlich ist die Pause keine Arbeitszeit und wird nicht bezahlt. Eine Ausnahme gilt, wenn Arbeitnehmende den Arbeitsplatz nicht verlassen dürfen, etwa wegen Kontrollaufgaben oder ständiger Einsatzbereitschaft. In solchen Fällen ist die Pause als Arbeitszeit zu vergüten.
3. Sonderregelungen für bestimmte Gruppen
Arbeitnehmende mit Familienpflichten können auf Wunsch eine verlängerte Mittagspause von mindestens 1,5 Stunden verlangen. Schwangere Frauen, die überwiegend stehend arbeiten, erhalten ab dem vierten Schwangerschaftsmonat zusätzlich alle zwei Stunden eine zehnminütige Pause. Müttern steht im ersten Lebensjahr des Kindes bezahlte Stillzeit zu – je nach Arbeitszeit bis zu 90 Minuten pro Tag.
4. Organisation und Mitspracherecht
Der Arbeitgeber bestimmt, wann und wie die Pausen stattfinden – idealerweise in der Mitte der Arbeitszeit. Dabei müssen die Interessen des Betriebs und der Arbeitnehmenden abgewogen werden. Mitarbeitende oder ihre Vertretung haben ein Anhörungsrecht, bevor die Pausenregelung festgelegt wird.
5. Rauch- und Toilettenpausen: Was gilt?
Rauchpausen sind keine gesetzlich garantierten Pausen. Arbeitgeber können verlangen, dass sie in die regulären Pausen gelegt werden.
Toilettenpausen: Laut jüngster Rechtsprechung dürfen Unternehmen verlangen, dass Mitarbeitende für Toilettengänge ausstempeln – vorausgesetzt, dies geschieht verhältnismässig und diskriminiert niemanden.
6. Ausserordentliche Unterbrechungen: Wann ist Freizeit zu gewähren?
Für dringende persönliche Angelegenheiten (z.B. Arztbesuche, Behördengänge, Stellensuche nach Kündigung) kann Anspruch auf bezahlte oder unbezahlte Freizeit bestehen. Diese Fälle sind jedoch von den Erholungspausen im engeren Sinn zu unterscheiden.
Das Wichtigste in Kürze
Pausen sind im Schweizer Arbeitsrecht klar geregelt und dienen dem Schutz der Arbeitnehmenden. Die Einhaltung der Mindestpausen ist zwingend – Ausnahmen sind nicht zulässig. Pausen gelten nur dann als Arbeitszeit, wenn der Arbeitsplatz nicht verlassen werden darf. Sonderregelungen bestehen etwa für Schwangere, Stillende und Arbeitnehmende mit Familienpflichten.
Tipps für die Praxis:
- Arbeitgeber sollten Pausen klar regeln, dokumentieren und deren Einhaltung überwachen.
- Mitarbeitende sollten ihre Pausen tatsächlich zur Erholung nutzen – auch im Homeoffice.
- Bei Unsicherheiten empfiehlt sich die Konsultation eines Treuhänders oder Arbeitsrechtsexperten.
- Individuelle Bedürfnisse und betriebliche Erfordernisse sollten in einer offenen Kommunikation gemeinsam abgestimmt werden.
Autor
Schweizerischer Treuhänderverband
Blog abonnieren
Möchten Sie keinen Blogartikel verpassen? Abonnieren Sie hier unseren Blog.
